![]() Sorben
Sorben![]() Bathow
Bathow![]() Spreewald
Spreewald ![]() Zinnitz
Zinnitz ![]() Calau
Calau
![]() Slawenburg
Raddusch
Slawenburg
Raddusch![]() .
.
Literatur
Die Lausitz ist ein ehemals historisches Territorium zwischen Elbe
, Oder und Neiße und hat sich als Gebietsbezeichnung erhalten .
Die Oberlausitz befindet sich im südöstlichen Teil Sachsens
sowie im Norden Böhmens und die Niederlausitz im Süden des Landes
Brandenburg.
Von den slawischen Stämmen der Luzici ( in der Niederlausitz) und Milzenen (Oberlausitz) einstmals besiedelt, leben heute noch in diesem Gebiet etwa 60000 Sorben als nationale Minderheit und pflegen ihre über viele Generationen bewahrte Volkskultur. Das bekannteste Touristengebiet der Niederlausitz ist wohl der Spreewald mit seiner in Europa einzigartigen Niederungslandschaft.
Nachfolgende Darstellungen und Links sollen dem geneigten Leser einen Eindruck der niederlausitzer Region vermitteln
![]() Sorben
Sorben![]() Bathow
Bathow![]() Spreewald
Spreewald ![]() Zinnitz
Zinnitz ![]() Calau
Calau
![]() Slawenburg
Raddusch
Slawenburg
Raddusch![]() .
.
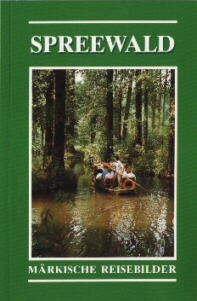 |
Spreewald
Karl -Heinz Otto & Wolfgang Garz Der kulturhistorische Reiseführer gewährt interessante Einblicke in die einzigartige Kulturlandschaft des Spreewaldes und in die traditionellen niedersorbischen Bräuche. Wir begleiten Sie durch die bewegte Geschichte des Spreewaldes und lassen Sie die seltenen Naturschönheiten genauso wie die kulturellen Sehenswürdigkeiten dieser weltweit einmaligen Flußlandschaft erleben, welche in jüngster Zeit unter den besonderen Schutz der UNESCO gestellt worden ist. Anhand von ausgewählten Ortschaften wird das Leben und Wirken der Spreewälder heute wie damals näher ins Blickfeld gerückt. Lehde - ein märkisches Venedig, Lübben, Lübbenau und Burg werden genauso vorgestellt wie Entdeckungen am Rande des Spreewaldes, wozu u.a.das Bauernmuseum in Schlepzig und die Straupitzer Schinkelkirche gehören. Professionelle Fotos vermitteln lebendige Eindrücke der reizvollen Auenlandschaft. Nicht zuletzt bietet ein interessanter Streifzug durch das Brauchtum der Sorben einen interessanten Einblick in die Lebensweise dieser einzigen in Deutschland lebenden slawischen Minderheit Ein deutsch-sorbisches Ortsregister mit touristischen Hinweisen vervollständigt das Büchlein.. |
Bathow - Dorf der Verwandten
In Christian Dienels Zinnitzer Chronik geblättert
/ Von Hemo Neumann(l)
| Bathow.
Der kleine Ort Bathow liegt im Nordostwinkel der Autobahnauffahrt Berlin-Dresden
(A 13) und der sie überquerenden Chaussee von Calau nach Luckau Er
ist Ortsteil der Gemeinde Zinnitz Bis 1816 gehörte Bathow zum Kreis
Luckau.
In der Gemarkung dieses kleinen Ortes gab es schon vor 1800 Jahren eine Siedlung Mitarbeiter des Museums Potsdam führten die Notbergung eines Grubenhauses aus der römischen Kaiserzeit durch, das durch den Braunkohletagebau angeschnitten wurde. Offenbar bot sich dieses Gelände immer wieder als Siedlungsraum an Der Bathower Graben (Fließ) - heute „neue" Schrake - im Osten, im Süden einst der Jehsersche See und im Nordwesten sowohl das Putka-Luschk (niedersor-bisch=Kükchen-Tümpel,) und der ehemalige Teich, östlich der Autobahn lassen erkennen, daß es hier einst sehr sumpf- und wasserreich war Als der slawische Stamm der Lusitzer in das Lausitzer Gebiet einwanderte (nach 600 n Chr), machten sich vielleicht an dieser Stelle zwei oder drei Familien, |
die
miteinander verwandt waren, seßhaft. Bathow heißt altsorbisch
Bat' ov = Dorf des Bat, zu urslawisch Bate = Bruder, Verwandter Also sagen
wir Dorf der Verwandten
An die sorbisch sprechenden Lusitzer erinnern nur die Orts- und Flurbezeichnungen und Familiennamen, wie Andrick, Galla, Haschke, Piezer. Archäologische Funde dieser Zeit sind bisher nicht gemacht worden Aber aus der frühdeutschen Zeit hat man sogenannte Hochäcker entdeckt. In Bathow kommen deutsche Namen hinzu, wie Richter oder Lehmann Es könnte sein, daß in dieser Zeit eine kleine Erdwallanlage erichtet wurde und zwar dort, wo man heute noch ein Wasserloch (nordöstlich vom Dorf) „Schanze" nennt. Archäologen haben wallartiges entdeckt, aber können nicht entscheiden, ob es ein Wall oder ein Teichdamm war Es ist durchaus möglich, daß Bathow mit Berlinchen zusammen als Kleinstsiedlung zum Herrschaftsbereich des Gebhard |
von Zinnitz (1255 n Chr) gehörte Erstmals urkundlich erwähnt wurde Bathow 1402, weiterhin 1455 und 1463/64, wo Batho zu den Besitzdörfern der von Buxdorf auf Zinnitz gehörte Mit den Jahren gab es auch verschiedene Schreibweisen für den Ortsnamen: Bato 1527, Bate 1761 und noch 1843, Bathow und Bathe 1928. Bis 1663 kann das Dorf Batho von den Buxdorfs in den Besitz gehalten werden Am 8 Juli 1663 mußte Heinrich von Buxdorf aus Geldnot „sein wüstes Gütlein", das durch den Dreißigjährigen Krieg zerstört und durch Armut völlig heruntergekommen war, an den Obersteuereinnehmer und Oberstleutnant Hans Zacharias von Klitzing auf Seese, halb Bischdorf und Buckow für nur 1000 Gulden, verkaufen Batho blieb für die folgenden Jahrzehnte zunächst im Besitz der Familie von Klitzing Carl Erdmann von Klitzing legte für Batho am 12 Februar 1749 die Lehnspflicht ab Der Ort zählt in der Sachsenherrschaft (ab 1635) 1708 und 1718 drei Kossäten bzw Gärtner, 1755 gab es 23 männliche und 31 weibliche Konsumenten. |
Wie das Gut Besitzer wechselte
In Christian Dienels Zinnitzer Chronik
geblättert/Von Heino Neumann (Folge 2)
| Am 8 März
1759 war Dorf und Gut Batho an Johann Christoph Paschke abgetreten worden
Dieser war gräflich-Lynarschcr Pächter auf dem neuen Vorwerk
zu Lübbenau. Paschke erscheint als Pächter von Stoßdorf,
Presehnchen, Kleedem, Bolschwitz, Sepuhl, Groß- und Klein-Beuchow
1747 wird er als Rittelgutsbesitzer von Stobntz gemeldet Paschke muß ein recht tüchtiger Mann gewesen sein. In Batho nahm zu seiner Zeit die Anzahl der Kossäten zu. Trotz allem verkaufte sein Sohn Christian Gottlob das Gut am 20. August 1795 fm l? 000 Thaier an den königlich preußischen Kriegs- und Steuerrat Christoph Wilhelm Freiherr von Werdeck auf Froden, der es aber schon 1797 für 14 000 Thaier an Carl August Paschke veräußert Auch im 19 Jahrhundert |
wechselt
das Gut die Besitzer recht häufig Die Preußenzeit (ab 1815)
bringt Jedoch Aufschwung in Dorf und Gut Für 35000 Thaier erwirbt
Karl Baldum Puscher aus Dresden 1855 das Gut
Nördlich des Ortes entdeckte man ein Wiesenkalklager von feinster Qualität. Man beginnt es auszubeuten und baute 1859/60 einen Brennofen. Von ihm erzählt man heute noch im Dorf. Ältere Einwohner kennen ihn als Spielplatz hinter Tobernas. Da die Ausbeute zu gering war, mußte der Betrieb nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder eingestellt werden Doch gab es auch einen anderen "Industriezweig" im Ort, der unbedingt genannt werden muß Es ist die Ziegelei Sie hatte für ein Jahrhundert erhebliche Bedeutung. Westlich des Dorfes, am Weg |
nach Zinnitz,
produzierte sie mindestens von 1800 an. Lehm war an dieser Stelle reichlich
vorhanden.
Die Ziegelmeister wohnten m einem noch heute erhaltenen Häuschen. In dem Wäldchen erkennt man noch die ehemaligen Lehmkieten Dort befindet sich auch ein Brunnen, der vor dem Bergbau sehr gutes Wasser spendete. Aus der Ziegelei stammen die Ziegel für den Bau des Zinnitzer Schlosses und der Kirche, wahrscheinlich auch für den Turm. Viele Häuser in Bathow und Zinnitz wurden ebenfalls mit diesem Material gebaut. Als Herr Burisch um 1880 Besitzer der Ziegelei war, ließ er eine neue Schankwirtschaft neben der kleinen alten Schenke errichten. Hier trafen und unterhielten sich Ziegeleiarbeiter und Dorfbewohner.Der Ziegelei-betrieb arbeitete bis über 1900 hinaus |
1864 wurde
das Gut nun schon für über 36 000 Thaier an den Ökonom Wilhelm
Adolf Henning verkauft
Noch 1885 wird er als Besitzer genannt Die Kalkbrennerei und die Ziegelei haben offenbar die Einwoh nerzahl von Bathow steigen lassen, so waren es 1871 schon 87 Einwohner Um 1900 sinkt sie jedoch auf nur 54 Einwohner Dies geschah sicherlich deshalb, weil die beiden wichtigen Betriebe geschlossen wurden Mit der Fischerei wurde ein neuer Wirtschaftszweig angekurbelt In dem großen Teich, der einst nordöstlich des Dorfes lag - heute sind hier nur noch Restlocher - betrieb offenbar das Gut mindestens seit dem Beginn des 20 Jahrhunderts intensiv Fischzucht, bis die Autobahn (A 13) 1938 gebaut wurde |
Vier Neusiedlungen entstanden
In Christian Dienels Zinnitzer Chronik
geblättert/Von Heino Neumann (Folge 3)
| Der letzte
Ritterguts- besitzer von 1920 von Bathow, hieß Waldemar Lehne. 1921
befindet sich das Gut schon in den Händen der Bergbau Ilse AG; ab
1923 gehort es dem Reichs-Eisenbahn- Fiskus. Die Größe des Gutes
wird 1863 mit 1152 Morgen angegeben, 1885 mit 295 Hektar (davon 110 Hektar
Acker und 156 Hektar Forsten) und 1929 mit 306 Hektar (davon 114 Hektar
Acker, 150 Hektar Forsten).
Das Herrenhaus, von der Bevölkerung "Schloß" genannt, war ein größerer Ziegelfachwerkbau (einstöckig) mit einer |
Neunfensterfront
und einfachem Spitzdach. Es konnte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
errichtet worden sein. Zuletzt diente es als Verwalter- haus, wurde aber
wegen Baufälligkeit in den sechziger Jahren abgerissen..
Nachdem die sowjetische Armee 1945 auch Bathow besetzte, wurde das Gut versiedelt. So entstanden östlich des Bathower Grabens vier Neusied- lungen. Seit 1938 durchschneidet die Autobahn Berlin-Dresden die Gemarkung von Bathow. Der direkte Weg nach Zinnitz, an der "Schinderheide" vorbei, |
wurde noch
als hölzerne Fuß-gängerbrücke über die Autobahn
erhalten. Dieser Steig wurde inzwischen wegen Verkehrsbehinderung abmontiert.
Die Bathower erreichen Zinnitz nur noch, in dem sie die Autobahnbrücke
überqueren. Bathow fand man auf jeder Karte als Autobahnabfahrt angegeben.
Heute ist sie als Abfahrt Calau/Luckau gekennzeichnet. In die Kirche gingen die Bathower schon seit 1346 nach Schlabendorf. Das Schlabendo-fer Gotteshaus war ihre Tauf- und Traukirche. Auch die Ver- |
storbenen
wurden auf dem dortigen Kirchhof beerdigt. Ältere Bathower erzählten
Christian Dienel, daß sie noch zu Fuß nach Bathow zum Konfirmandenunterricht
gelaufen sind.
Erst 1925/26 richtet das Dorf einen eigenen Friedhof ein. 1929 beschlossendie Gemeindekirchenräte von Schlabendorf und Zinnitz, Bathow nach Zinnitz einzupfarren. Die Bathower Kinder gingen schon immer nach Zinnitz in die Schule. Der grüne Weg war ihr Schulpfad. Heute werden alle Schüler in Calau unterrichtet. (Schluß) |
Aus: Lausitzer Rundschau